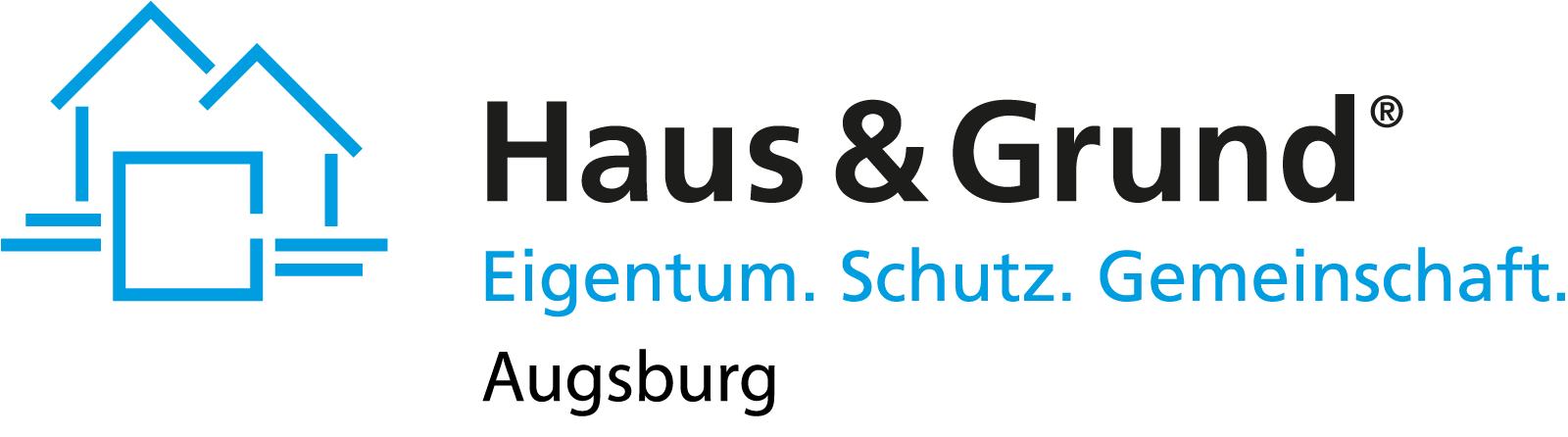


Augsburg und Umgebung e.V.
86150 Augsburg
Tel. 0821 345270
Fax 0821 3452727
» E-Mail schreiben
Energiewende I
Verbot von Gas- und Ölheizungen ab 2024 - nur „Theaterdonner“?
Mit der geplanten Novelle des Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) hat Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck ordentlich für Wirbel bei Hauseigentümern gesorgt.
Noch ist der Entwurf „hausintern“, also unter den übrigen beteiligten Ministerien (zum Beispiel dem Bundesjustizministerium) noch nicht abgestimmt. Erst seit dem 7. März 2023 beginnt die Ressortabstimmung. Erst recht gibt es noch keinen Kabinettsentwurf oder gar einen Kabinettsbeschluss. Trotzdem: „Reiner Theaterdonner“ sind seine Pläne durchaus nicht.
Entwurf
Der „Habeck-Entwurf“ will den Einbau neuer reiner Gas- und Ölheizungen ab dem 1. Januar 2024 verbieten.
Vorhandene Systeme rein auf Basis der genannten Energieträger dürfen zunächst weiter betrieben werden. 30 Jahre nach ihrem Einbau müssen sie getauscht werden, auch wenn sie weiterhin reibungslos funktionieren. Fangen sie an zu „knattern“, dürfen sie repariert werden. Auch in diesem Falle gilt dann die genannte Altersgrenze für ihren Betrieb von 30 Jahren seit ihrem Einbau. Können Sie nicht mehr repariert werden, müssen sie also ersetzt werden, sind folgende Möglichkeiten vorgesehen:
Entweder man schwenkt auf Heizsysteme mit Warmwasseraufbereitung um, die mit rein regenerativer Energie betrieben werden (Sonne, Wasser, Wind, Erdwärme, Biomasse, Holzpellets/Holzschnitzel, Strom, Wasserstoff), oder man wählt einen „hybriden Weg“. 65 % der verbrauchten Energie müssen dann regenerativ sein und zum Beispiel durch Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Solarthermie, Stromheizkörper oder durch Fernwärmeheizungen verwertet werden, 35 % des Verbrauchs dürfen weiter aus fossilem Brennstoff (Gas, Öl, Kohle) bestritten werden.
Neubauten sollen mit Wärmepumpen als „Standardlösung“ ausgerüstet werden, oder mit Stromdirektheizungen oder schließlich mit Fernwärmeanschluss. Für Bestandsgebäude käme auch eine Biomasseheizung als Alternative hinzu. Entscheidet man sich hier für Holz als Energieträger, sollte eine davon ausgehende Feinstaubbelastung nicht aus dem Blick geraten!
Lässt sich das bautechnisch, wirtschaftlich oder von den verfügbaren Kapazitäten an Baumaterial und Handwerkerterminen nicht sofort bewerkstelligen, sind zwei Übergangslösungen vorgesehen: Der Hauseigentümer entscheidet sich für eine Wärmepumpe, die den Energiebedarf regenerativ zu 65 % deckt. Dann darf er noch 3 Jahre lang ersatzweise eine Brennwertheizung mit fossilen Energieträgern betreiben, bis die Wärmepumpe eingebaut sein muss. Oder er entscheidet sich für einen Anschluss an das Fernwärmenetz. Dann gilt bis zum geplanten Anschluss eine Übergangsfrist für den ersatzweisen weiteren Betrieb einer Brennwertheizung von 5 Jahren.
In jedem Fall ist die bereits nach aktuellem Recht geltende Höchstbetriebsdauer von 30 Jahren seit dem Heizungseinbau zu beachten. Unabhängig davon soll der Betrieb reiner Gas- und Ölheizungen spätestens 2045 verboten werden, um die erstrebte Klimaneutralität im Gebäudebereich durch energetische Ertüchtigung zu gewährleisten und dazu jeden CO₂-Ausstoß beim Verbrauch von Heizenergie sowie von Energie zur Warmwasseraufbereitung zu vermeiden.
Ausnahmen:
Für Mehrfamilienhäuser ohne Zentralversorgung und mit Gasetagenheizung gilt eine Übergangsfrist von insgesamt 6 Jahren, also bis zum Jahre 2030. Aber: beim Ausfall der ersten Gasetagenheizung muss binnen 3 Jahren eine Heiztechnik nach den neuen Anforderungen realisiert werden, wenn es bei der wohnungsbezogenen Einzelversorgung bleiben soll. Möchte man auf eine Zentralversorgung umschwenken, gibt es dafür dann weitere 3 Jahre Zeit. Nur in Härtefällen, in denen der Umstieg für den Hauseigentümer „aus besonderen Gründen wirtschaftlich unzumutbar“ ist, kann von den neuen Pflichten befreit werden. Nähere Regelungen dazu sind unklar.
Bewertungen
Die Bewertung der Baubranche - „völlig unrealistisch“!
Die Baubranche - zusammengefasst aus Industrie und Handwerk – berichtet, das im Jahre 2022 bei 1 Million verbauter Heizungen in Deutschland 2/3 reine Gas- und Ölheizungen installiert wurden. Denn viele Gebäude sind bautechnisch noch nicht aufnahmefähig für moderne Heizsysteme, die mit regenerativer Energie betrieben werden. Das gilt insbesondere für den erstrebten Betrieb von Wärmepumpen. Bausanierungen werden also vorgreiflich nötig sein. Dazu werden Handwerkerressourcen, Baumaterialien und Ausführungstermine benötigt, so Christoph Blepp, Berater in der Baubranche im WDR 5 Morgenecho – Interview sm 06.03.2023.
Und weiter: Sollen ab 2024 verstärkt Wärmepumpen verbaut werden, müssen also mehr Gebäudesanierungen vorgreiflich erfolgen. Die dafür notwendigen Handwerkerkapazitäten fehlen. Schon deshalb ist der Habeck-Entwurf als unrealistisch zu bewerten.
Schon jetzt existiert das Ziel, bis zum Jahre 2045 in Deutschland klimaneutral zu werden. 40 % der CO₂-Emissionen sollen dabei aus dem Gebäudebestand kommen. Das bedeutet, dass es dann im Jahre 2045 tatsächlich keine betriebenen Gas- und Ölheizungen mehr geben soll. Wenn sie vor allem durch Wärmepumpen und durch Photovoltaiksysteme ersetzt werden sollen, müssen sie in der ausreichenden Zahl vorproduziert worden sein. Die Industrie baut entsprechende Produktionskapazitäten in beiden Bereichen auf. Dies aber über Nacht schon bis zum Jahre 2024 nicht möglich. Den Vorstellungen Robert Habeck‘s fehlt deshalb eine realistische Grundlage. Für eine realistische Umstellung ist folgendes zu bedenken: in Deutschland existieren ca. 41 Millionen Haushalte; davon werden 30 Millionen Haushalte mit Gas- und Ölheizungen versorgt. Lassen sich von den verfügbaren Kapazitäten 1 Million Heizungen pro Jahr tauschen, wären bis zu einem vollständigen „Roll Over“ 30 Jahre notwendig!
Die Bewertung von Haus & Grund:
Mit dem Hinweis auf fehlende Industriekapazitäten, Handwerkerüberlastungen und ein wirtschaftlich untragbares wie unzumutbares Finanzopfer bewertet auch Haus & Grund. Und: „Der Gesetzesentwurf aus dem Wirtschaftsministerium zeigt, dass Minister Habeck bei der Energiewende im Gebäudebestand ausschließlich auf Zwang und Verbote setzt. Die soziale Marktwirtschaft hat hier offenbar keinen Platz mehr. Das wird für viele Menschen gerade in älteren Einfamilienhäusern unbezahlbar. Jetzt hilft nur noch ein konsequentes Eingreifen des Bundeskanzlers“, so Verbandspräsident Dr. Kai H. Warnecke. Auch der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft warnt vor Überteuerung und Kapazitätsengpässen
Die Bewertung durch den Deutschen Städte- und Gemeindebund:
„Die Umstellung der Wärmeerzeugung zu beschleunigen, ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz. Wir warnen allerdings davor, hier nun Fristen in den Blick zu nehmen, die unrealistisch sind und die jetzt bereits laufenden, zum Teil sehr komplexen Planungen bei kommunalen Bauvorhaben gefährden“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg.
Die Bewertung der Politik:
Die Bundesunion lehnt als politische Opposition die Pläne mit den hier schon vorgestellten Argumenten ab. Auch aus der Ampel selbst kommt Widerspruch von der FDP. Ihr wohnungsbaupolitischer Sprecher, Daniel Föst, bezeichnet den Entwurf als nicht zustimmungsfähig. Er schieße weit über die Vereinbarung der Koalition hinaus. Kritische Töne kommen auch aus Niedersachsen von Bauminister Olaf Lies. Auch er warnt vor den Folgen der geplanten Novelle des GEG. Vor allem die Fristen zur Umrüstung von Heizungsanlagen würden die Baubranche sowie Haus- und Wohnungseigentümer überfordern.
Die eigene Bewertung:
Olaf Lies hat absolut recht. Den hier skizzierten Argumenten und Schlussfolgerungen kann man sich nur anschließen. Ungeklärte technische Umsetzung und eine immens überfordernde wirtschaftliche Belastung der betroffenen Immobilieneigentümer zeigen sich geradezu als „Fallbeil“. Klimaschutz, so wichtig er ist, und bezahlbare Mieten entfernen sich immer weiter voneinander. Knallharte Ordnungspolitik beim Klimaschutz „nach Gutsherrenart“ - schier absolutistische Machtformen erinnernd - lösen dies nicht - und können dies auch nicht lösen, weil ein ganzes Pflichtenheft von Geboten und Verboten noch nie zu einer technischen Umsetzbarkeit und Bezahlbarkeit geführt hat!
Man kann nur hoffen, dass die Haltung Niedersachsens über den Bundesrat Schule macht und zum Scheitern der Novelle in der augenblicklichen Planung führt, wenn die Bundesregierung nicht selbst vernünftig werden sollte.
Fakten
Die Fakten nach aktuellem Recht:
Schon nach der aktuellen Fassung des Gesetzes zur Vereinheitlichung des Energieeinsparungsrechts für Gebäude und zur Änderung weiterer Gesetze (Gebäude-Energie-Gesetz - GEG - vom 8.8.2020, BGB l. I/2020, Nr. 37 vom 13.8.2020, S. 1728; ein vgl. §§ 47, 71, 72 GEG) bestehen Voraussetzungen für den Betrieb eines älteren Heizsystems. Geregelt sind dort insbesondere
- Anforderungen an Energieausweise,
- Energiestandards für die Sanierung; geht es um Instandsetzungsmaßnahmen und sind von dem einzelnen zu betrachtenden Gewerk mehr als 10 % der Baumasse betroffen, müssen die aktuellen gesetzlich vorgegebenen Energiestandards im Zuge der Baumaßnahmen bereits umgesetzt werden (§ 46 Abs. 1 Satz 1 und 2 GEG in Verbindung mit Anlage 7 des Gesetzes).
Beispiele:
Sollen weniger als 10 % der Fassadenfläche instandgesetzt werden, kann dies so ohne weiteres geschehen. Sind mehr als 10 % der Fläche betroffen, müssen die neuen aktuellen energetischen Standards zur Fassadendämmung berücksichtigt werden.
Fenster: Werden mehr als 10 % der vorhandenen Fenster ausgetauscht, kommt es auf die insgesamte Einhaltung des aktuell geltenden Wärmedurchgangskoeffizienten an.
Genauso ist es beim Dach: Soll die Dacheindeckung inklusive der Unterlattierung erneuert werden, muss auch hier der vorhandene Wärmeschutz im Hinblick darauf überprüft werden, ob er die aktuellen energetischen Werte einhält. Ist das nicht so, muss eine Dämmung zusätzlich eingebaut werden. - Voraussetzungen eines angeordneten Heizungstausches, und
- sonstige Sanierungspflichten.
Die Sanierungspflicht betrifft die Bereiche
- Dämmung von wärmeführenden Leitungen (Heizungsleitungen und Warmwasserleitungen),
- Dämmung der obersten Geschossdecke, die zum Bereich des Dachbodens hin abschließt,
- Voraussetzungen des Betriebs älterer Heizsysteme und Pflicht zum Heizungsaustausch für 30 Jahre alte Heizungen unabhängig von deren Funktionsfähigkeit (Konstanttemperaturkessel),
Für selbst bewohnte Ein- bis Zweifamilienhäuser gibt es im Falle des Eigentümerwechsels eine „Schonfrist“: Der neue Eigentümer muss dann innerhalb von zwei Jahren seit Übergang des Eigentums den geregelten Nachrüstpflichten insgesamt (Dämmung von wärmeführenden Leitungen, Dämmung der obersten Geschossdecke zum Bereich des Dachbodens, Betriebsvoraussetzungen für ältere Heizsysteme und Pflicht zum Austausch nach 30 Jahren) genügen (§ 47 Abs. 3 GEG). Davon umfasst ist jede Form des Eigentumsübergangs, also nicht nur ein Verkauf. Dazu zählen auch Schenkungen oder teilentgeltliche Erwerbe in vorweggenommener Erbfolge oder losgelöst davon, und generell ererbte Immobilien.
Für Eigentumswechsel bei Mehrfamilienhäusern gilt diese Schonfrist nicht. Hier trifft den Erwerber der genannte „energetische Pflichtenkatalog“ übergangslos sofort.
Unabhängig von einem Veräußerungsfall gibt es zurzeit über die genannten Pflichten hinaus noch keine unbedingten Sanierungspflichten / Nachfristpflichten, die Hauseigentümer erfüllen müssen.
Darauf aufsetzend bestimmt der Koalitionsvertrag der „Bundes-Ampel-Regierung“ den Umbau der Heizsysteme sowie der Technik zur Warmwasserversorgung ab dem 1. Januar 2025 bis hin zur geplanten Klimaneutralität in Deutschland auch im gebäudeenergetischen Sektor bis 2045 mit „0-Emissions-Standard“. Ukrainekrieg und Energiekrise waren Anlass, dieses Vorhaben um ein Jahr auf den 1. Januar 2024 vorzuziehen.
Mit diesem Ausgangsszenario muss viel von dem als Realität erwartet werden, was jetzt noch als Plan erscheint und als solcher verharmlost wird. Die bautechnischen und wirtschaftlichen Folgen für den Gebäudesektor insbesondere im Immobilienbestand werden immens sein.
Häufig gestellte Fragen:
Angst, Verunsicherung und nicht selten auch Wut sind bei den Betroffenen groß. Das ist durchaus verständlich. Können wir unsere Häuser denn überhaupt noch halten, so fragen sich insbesondere ältere und damit nicht mehr so einkommensstarke Eigentümer. Hier einige Fragen aus dem Beratungsgeschäft:
Mietshaus
In meinem Mietshaus betreibe ich eine Gas- oder Ölheizung. Welche Pflichten treffen mich, wenn die Heizung alt ist?
Ist sie noch nicht 30 Jahre alt, darf sie weiterbetrieben und im Falle einer Störung auch repariert werden. Ist sie nicht mehr reparabel und muss sie deshalb ausgetauscht werden, sieht der Gesetzesentwurf im Falle einer gewählten Wärmepumpe oder eines Fernwärmeanschlusses Übergangsfristen vor, in denen noch fossile Brennwertheizungen „ersatzweise“ eingesetzt werden können. Welches Heilsystem mit welchem Baualter wann ausgetauscht werden muss, wird in § 70 GEG geregelt.
Unabhängig davon sollte überlegt werden, ob man bereits im Jahre 2023 noch ohne die skizzierten technischen Beschränkungen eine Modernisierung der Heizungsanlage plant und umsetzt. Energieberater begleiten beim Thema „Förderung“, so Thomas Bertram, Verbraucherzentrale NRW im WDR 5 Morgenecho - Interview. 07.03.2023. Eine erste eigene Übersicht gewinnt man auf den Internetseiten der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), bzw. auf den Onlineportalen der landeseigenen Förderbanken (z. B. NBank für Niedersachsen; NRW-Bank für Nordrhein-Westfalen).
Funktionierende Heizung
Was gilt bei einer noch ziemlich neuen Gas- oder Ölheizung?
Eine funktionierende Heizung muss nicht getauscht werden, erst recht dann nicht, wenn sie noch relativ neu ist. Sie kann weiterhin betrieben und repariert werden. Sollte auch in diesem Fall über eine Modernisierung nachgedacht werden? Viele Energieberater und Verbraucherzentralen raten dazu. Sie geben den Hinweis, dass erneuerbare Energien fossile Brennstoffe einsparen, verkennen dabei aber die naheliegende Opportunitätsrechnung - wie viel Kapital spare ich, wenn ich eine noch relativ neue und funktionierende Heizung nicht wegwerfe und nicht überdies auch noch in neue Heizsysteme investiere?.
Erwägenswert erscheint aber die Überlegung, wie man vorhandene fossile Brennwertsysteme mit Technik zur regenerativen Energiegewinnung unterstützen kann, so zum Beispiel mit einer Solarthermie-Anlage, die die Wärme aus der Sonne speichert und über Wärmespeicher wieder an die Heizung und den Warmwasserkreislauf abgibt, oder mit einer Photovoltaikanlage, die Wärmeenergie in Strom umwandelt. Auch die Wärmepumpe kann kombiniert werden. Die schon angeratene Wirtschaftlichkeitsberechnung (ersparte Kosten durch den ersparten Verbrauch fossiler Energie gegenüber Anschaffung- und Betriebskosten der neuen Technik) ist in jedem Fall durchzuführen.
Schließlich noch ein Hinweis auf das geplante „Aus“ für den Betrieb fossiler Heiztechnik im Jahre 2045; hier sollte im Wege einer Modernisierungsplanung und Umsetzung ein staatlich aufgegebener Umbau „nicht auf den letzten Drücker“ erfolgen. Andernfalls laufen Zeit und Preise möglicherweise davon.
Vorhandene Wärmepumpe
Als Vermieter habe ich bereits eine Wärmepumpe installieren lassen. Muss ich mich jetzt trotzdem um das neue Gesetz kümmern?
Ist eine Wärmepumpe - Erdwärmepumpe oder Luftwärmepumpe - bereits eingesetzt und deckt sie den vollen Energiebedarf oder zumindest 65 % davon, ist nichts zu veranlassen. Häufig berichtet die Praxis aber darüber, dass insbesondere Erdwärmepumpen bei niedrigen Außentemperaturen die notwendige Heizleistung nicht abgeben können. Dann gebietet zwar der „Habeck-Entwurf“ kein Tätigwerden, wohl aber der eigene „Wohlfühlfaktor“. Ob man dann zusätzlich in Kombination zum Beispiel mit einer Photovoltaikanlage arbeitet oder Gebäudehülle, Fenster, Türen und Dach stärker dämmt, ist eine Einzelfallfrage - sowohl in technischer wie insbesondere auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
Baurechtlich gibt es im Übrigen keine Abstandsflächen mehr für Wärmepumpen zur Grundstücksgrenze des Nachbarn. Im Falle kleinerer Grundstücke, engerer Bebauungen oder ungünstigerer Schallverhältnisse sollte man aber die von den Pumpen ausgehenden Geräuschemissionen bedenken; sie können dann schnell zum Streit unter Nachbarn führen. Die bislang dazu ergangene Rechtsprechung legt dafür ein beredtes Zeugnis ab.
Alte Öl- oder Gasheizung mit Warmwasseraufbereitung
Mein Eigenheim wird mit einer alten Öl- oder Gasheizung beheizt. Sie sorgt auch für die Warmwasseraufbereitung. Folgen für mich?
Häufig liest man, dass Eigenheime - das sind nach dem Verständnis des Entwurfs selbst bewohnte Ein- bis Zweifamilienhäuser - von den ganzen Pflichten ausgenommen bleiben sollen. Deren Eigentümer sollen also nicht verpflichtet sein, nach den Vorgaben des „Habeck-Entwurfs“ zu arbeiten. So ganz stimmt das nicht. Denn die 65 %-Regel gilt im Falle des Austauschs ausnahmslos.
Nur: In diesen Fällen ist der Eigentümer nicht verpflichtet, bestehende Technik zu ersetzen, solange sie funktioniert oder repariert werden kann und schließlich in der Betriebsdauer nicht zu alt wird. Dabei soll das Betriebsverbot für 30 Jahre alte Heizkessel zeitlich nach hinten verschoben gelten (§ 72 Abs. 3 GEG-E). Je nach Einbaualter soll dann die 30 Jahrefrist erst ab dem 31.12.2030 beim Einbau vor dem 1. Januar 1996, ab dem 31. Dezember 2031 bei einem Heizungseinbau zwischen dem 1.1.1996 und dem 31. 12. 1998, ab dem 31. Dezember 2032 für einen Einbau zwischen dem 1. Januar 1999 und dem 31. Dezember 2001, und schließlich ab dem 31. Dezember 2033 für Heizkessel gelten, die nach dem 31. Dezember 2031 eingebaut oder aufgestellt wurden. Dieselben Fristen gelten dann auch für die Beachtung des Dämmgebots für wärmeführende Rohrleitungen (§§ 72 Abs. 3 Satz 1, 69 Abs. 2 GEG-E).
Und: Beim Eigentümerwechsel soll die Schonfrist von 2 Jahren seit dem Erwerb weiterhin gelten.
Aktuell sieht für diese Immobiliengruppe das geltende Recht vor, eine Heizung nur dann zu tauschen, wenn sie 30 Jahre lang in Betrieb ist (§ 72 Abs. 2 - Ausnahmen für Niedertemperatur- Heizkessel und Brennwertheizungen in Abs. 3 - GEG). Die genannten Ausnahmen sind im „Habeck-Entwurf“ nicht mehr enthalten!
Was gilt in diesem Fall bei einer noch ziemlich neuen Gas- oder Ölheizung?
Auch für noch relativ neue Gas- oder Ölheizungen gibt es keine unterschiedlichen Regelungen.
Pflicht zur Prüfung/Optimierung
Gibt es eine Pflicht zur Prüfung und Optimierung der Heizung?
Schon aktuell verpflichtet die Verordnung zur Sicherung der Energieeinsparung über mittelfristig wirksame Maßnahmen vom 23.9.2022 zu einem Heizungsscheck in Form einer Prüfung und optimierten Heizungseinstellung einschließlich eines hydraulischen Abgleichs bei Mehrfamilienhäusern ab 6 Wohneinheiten. Sie ist seit dem 1. Oktober 2022 in Kraft (BGBl. I/Nr. 34/2022, Seite 1530 ff.) und gilt bis zum 30. September 2024.
Arbeitet die Heizungsanlage mit Wasser als Wärmeträger und ist sie vor dem 1. Oktober 2009 eingebaut worden, ist eine Pflicht zur Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung, bis zum 1. Oktober 2027 zu erfüllen, vorgesehen. Wurde die Anlage nach dem 1. Oktober 2009 in Betrieb genommen, darf seit dem Einbau 15 Jahre lang abgewartet werden. Danach ist sie innerhalb eines Jahres nach Ablauf der genannten Frist zu prüfen und zu optimieren. Für neu eingebaute Heizungen sieht der Entwurf Vorgaben zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs vor.
WEG
Gibt es Besonderheiten für Wohnungseigentümergemeinschaften?
Ja, hier hält der Entwurf Überraschungen in Form von Sonderregelungen bereit (§ 71 l GEG-E). Zunächst wird der Verwalter bei Wohnungen mit Etagenheizung in die Pflicht genommen. Er muss bis zum 31. März 2024 die Sondereigentümer auffordern alle Informationen mitzuteilen, die für die Planung einer Zentralheizung mit Warmwasseraufbereitung notwendig sind (zu den Informationsdetails vergleiche § 71 l Abs. 1 Satz 2 GEG-E). Die so gesammelten Informationen hat der Verwalter zu koordinieren und an die Gemeinschaft zu kommunizieren (§ 72 l Abs. 2 GEG-E). Steht der Tausch einer Etagenheizung an, hat der Verwalter eine Eigentümerversammlung einzuberufen, um ein Konzept zur Umsetzung der energetischen Anforderungen an die neue Heiztechnik (mindestens 65 % EE, maximal 35 % FE) zu beschließen (§ 72 l Abs. 4 GEG-E; beachte die zu § 25 Abs. 1 WEG abweichenden Stimmquoren in § 71 l Abs. 5 GEG-E). Die Kostenverteilung regelt Abs. 6 der Vorschrift, das Verfahren für Gebäude mit zentraler Wärmeversorgung Abs. 8. Bei all dem werden auch die Kompetenzen des Verwalters im Innenverhältnis zur Gemeinschaft der Wohnungseigentümer abweichend von § 27 Abs. 2 WEG speziell geregelt (§ 71 l Abs. 9 GEG-E). Anders als nach der zitierten Grundnorm können sie nach Satz 1 der Vorschrift durch die Gemeinschaft nicht eingeschränkt werden. Satz 2 der Vorschrift beinhaltet einen gesetzlichen Anspruch auf Sondervergütung für den Verwalter, soweit nicht bereits im Verwaltervertrag für derartige Maßnahmen geregelt.
Abs. 10 der Vorschrift überträgt die dem Verwalter eingeräumten Pflichten und Befugnisse auf dem Beiratsvorsitzenden, dessen Vertreter oder einen durch Beschluss dazu ermächtigten einzelnen Wohnungseigentümer, wenn es für die GdWE keinen Verwalter gibt.
Verbundenheit an Energieträger/Vorgaben
Wenn ich jetzt im Jahre 2023 in eine neue Heiztechnik investiere, bin ich dann schon an bestimmte Energieträger und damit an bestimmte technische Vorgaben gebunden?
Nein, die einschränkenden technischen Vorgaben des „Habeck-Entwurfs“ sollen erst ab dem 1. Januar 2024 gelten (§§ 71 ff GEG-E in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 des Gesetzes zur Änderung des Gebäude-Energie-Gesetzes und mehrerer Verordnungen zur Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien - Stand 15.2. / 7.3.2023).
Kostenbeteiligung der Mieter
Angenommen, ich entschließe mich zum Einbau einer neuen Heiz- und Warmwasseraufbereitung. Kann ich meine Mieter an den Kosten beteiligen?
Erzielen Sie eine Energieeinsparung oder verbessern Sie den Wohnkomfort, liegt mietrechtlich eine Modernisierung vor (§ 555 b Nr. 1, 2 und 4 BGB). Ob Sie unter Umständen zu diesem Schritt von Gesetzes wegen sogar gehalten sind, bleibt unbeachtlich. Denn eine Modernisierung liegt auch vor, wenn sie auf gesetzlichen Vorgaben beruht und Sie sich also nicht freiwillig dazu entschließen können (§ 555 b Nr. 6 BGB; Modernisierung aus Umständen, die vom Vermieter nicht zu vertreten sind). Entweder Sie einigen sich zu den Details einschließlich einer nachfolgenden Mieterhöhung mit Ihrem Mieter auf der Grundlage einer zweiseitigen Vereinbarung (Modernisierungsvereinbarung; § 555 f BGB), oder Sie gehen einseitig vor. Dann müssen Sie mindestens 3 Monate vor Baubeginn dem Mieter schriftlich ankündigen, was Sie wann vorhaben, wie lange die Baumaßnahmen voraussichtlich dauern, müssen den Effekt einer Modernisierung erläutern, und bereits hier Auswirkungen in Form einer erhöhten Miete und eines veränderten Betriebskostenniveaus darstellen, berechnen und erläutern. Nach Beendigung der Baumaßnahme können Sie dann schriftlich die Miete modernisierungsbedingt erhöhen. Anzusetzen sind 8 % der investierten Baukosten sowie Baunebenkosten auf die Jahresmiete, aufgeteilt und zugeordnet zu der einzelnen Wohnung, für die Sie die Mieterhöhung aussprechen (§ 559 Abs. 3 BGB). Zuvor müssen Sie aber die anzusetzenden Baukosten bereinigen, und zwar
- um die real anzusetzenden Instandsetzungskosten, die im Falle einer Heizungsreparatur der alten Technik anfallen würden (§ 559 Abs. 2 BGB), und zum anderen um sogenannte
- „fiktive“ Instandsetzungskosten, die einen Abzug rein wegen des Alters der ersetzten Technik gebieten, auch wenn sie beim Austausch noch mangelfrei funktioniert (BGH, Urteil vom 17.6.2020 - VIII ZR 81/19, DWW 2021, 54).
- Besonderheiten gelten im Falle einer Modernisierung durch Einbau einer Wärmepumpe; hier dürfen als Berechnungsgrundlage nur 50 % der eigentlich ansetzbaren Kosten berücksichtigt werden, wenn der Vermieter nicht den Nachweis erbracht hat, dass die Jahresarbeitszeit der Wärmepumpe über 2,5 liegt und die Ausnahme eines nicht erforderlichen Nachweises nicht greift (im Einzelnen vgl. § 71 m Abs. 3 und 4 GEG-E).
Von dem so gebildeten Mietaufschlag auf die Jahresmiete errechnen Sie den Aufschlag auf die Monatsmiete und danach auf den Quadratmeter des vermieteten Wohnraums monatlich.
Liegt die bisherige Miete unter 7 € pro Quadratmeter monatlich, darf der Erhöhungsbetrag – betrachtet für 6 Jahre - 2 € pro Quadratmeter monatlich nicht übersteigen; bei einem Mietniveau ab 7 € pro Quadratmeter monatlich oder höher beträgt der Erhöhungsbetrag maximal 3 € pro Quadratmeter monatlich (§ 559 Abs. 3a BGB). Der zuvor errechnete Erhöhungsbetrag auf der reinen 8 %-Basis wird also in dieser Höhe gekappt. Deshalb spricht man bei den genannten quadratmeterbezogenen Maximalwerten auch von einer „Kappungsgrenze.“
Achtung: Der Mieter kann eine Mieterhöhung mit dem Einwand einer dann für ihn entstehenden wirtschaftlichen Belastung kontern ((§ 559 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 BGB). Ob sein Einwand zieht, ist fallbezogen durch einen Interessenvergleich zum Vermieter zu beantworten.
Aber: Können Sie Ihren Heizungsumbau auf gesetzliche Vorgaben stützen, darf die Miete ohne Abwägung zwischen den Interessen der Vertragsbeteiligten erhöht werden (§ 559 Abs. 4 S. 2 Nr. 2 BGB).
Betriebskostenabrechnung
Welche Betriebskosten muss der Mieter dann tragen?
Wird auf neue Heiztechnik umgestellt, muss der Mieter nicht alle anfallenden Kosten verbrauchter Heizungsenergie tragen (§ 71 m Abs. 1 und 2 GEG-E). Er trägt bei Heizungen, betrieben mit einem gasförmigen Brennstoff, mit einem biogenen Anteil oder mit Wasserstoff, nur die Kosten des verbrauchten Brennstoffs bis zu der Höhe des Grundversorgungstarifs für Erdgas auf Basis des Grund- und Arbeitspreises, der in dem jeweiligen Netzgebiet gilt. Im Falle eines Direktversorgungsvertrags regelt § 71 m Abs. 1 Satz 2 GEG-E einen Ersatzanspruch des Mieters gegenüber dem Vermieter in Höhe der Differenz zu den ihm direkt in Rechnung gestellten Kosten.
Andernfalls ist bei entsprechend gewähltem Heizsystem mit biogenen festen oder flüssigen Brennstoffen der jährliche Durchschnittspreis des ersetzten fossilen Brennstoffs zugrunde zu legen, wenn der Preis des biogenen Brennstoffs pro Energieeinheit höher ist als der Preis des ersetzten fossilen Brennstoffs
Ausblick
Im Gespräch ist auf EU-Ebene ein Entwurf der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie (Energy Performance of Buildings Direktive - EPBD - Entwurfsfassung der Europäischen Kommission vom 14.12.2021), der verpflichtende energetische Mindeststandards für Gebäude enthält. Nach aktuellen Vorstellungen könnte dies ab dem Jahre 2027 greifen. Auch über eine „Solardachpflicht“ für den Immobilienbestand und nicht nur für den Neubau wird laut nachgedacht.